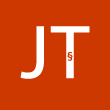Weithin ist das Szenario bekannt, eine Person beantragt die Bewilligung eines Hilfsmittels bei der Krankenkasse. Die Krankenkasse selber hat kein medizinisches Personal und nicht die Erlaubnis die notwendigen Daten zu erheben und zu speichern, so dass die Krankenkasse selber die medizinische Begründetheit des Antrages nicht prüfen kann. Dafür kommt dann der Medizinische Dienst der Krankenversicherung „MDK“ ins Spiel, wo Ärzte die Anträge prüfen.
Bisher wurden die Daten mehr oder weniger geschützt an die Krankenkasse geschickt, oft in einem separaten Umschlag, der dann vom MDK oft zur „Archivierung“ an die Krankenkasse zurück geschickt wurde.
Nun hat der Gesetzgeber auf eine Initiative der Datenschutzbeauftragten hin klargestellt, dass die Unterlagen direkt an den MDK geschickt werden sollen. Dazu wurde ein Weiterleitungsbogen (Muster 86, siehe oben) erstellt, den die Krankenkasse dem Versicherten nach Antragstellung zusammen mit einem Freiumschlag zusenden muss und mit dem er dann die Unterlagen direkt an den MDK schicken kann.
Das klingt nett, so sind die Daten doch gut geschützt vor der Krankenkasse, aber in der Praxis erschließt sich das ganze wenig. Denn, die leistungsrechtliche Entscheidung liegt weiterhin (ausschließlich) bei der Krankenkasse. Diese bekommt vom MDK eine gutachtliche Stellungnahme, in der der Gesundheitszustand des Versicherten beschrieben wird, auf deren Basis entscheidet sie dann. Aber geheim sind die Daten aus dem Gutachten nicht. Außerdem werden die maßgeblichen Umstände der Krankenkasse schon in einem Widerspruchsverfahren spätestens aber in einem Klageverfahren bekannt. Denn, wenn die Krankenkasse von dem Bedarf oder der Indikation bezüglich des Hilfsmittels nicht überzeugt ist, wird sie den Antrag ablehnen. Nun kann man einen Widerspruch einlegen und selbstverständlich als Begründung schreiben „aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Begründung geheim“, das tut der Wirksamkeit des Widerspruchs formelrechtlich keinen Abbruch, allerdings wird man dann wohl kaum eine positive(re) Entscheidung als im ersten Bescheid erhalten. Also wird man – um den Widerspruchsausschuss zu überzeugen – ohnehin sehr kleinteilig Stellung nehmen. Spätestens aber im Gerichtsverfahren muss man die Indikation und den Bedarf für das Hilfsmittel beweisen und wird dem Gericht entsprechende Unterlagen vorlegen, das Gericht wird diese an die Krankenkasse weiterleiten, auch etwaige Gutachten von gerichtlich bestellten Sachverständigen erhält die Krankenkasse zur Kenntnis. Häufig wird man mit der Geheimniskrämerei – wenn man sie denn versucht durchzuziehen – das Verfahren verlängern.
Auch an weiterer Stelle zeigt sich, dass der Gesetzgeber den Weg nicht bis zum Ende gedacht hat. Aufgrund des Patientenrechtegesetzes (Patientenrechtegesetz: Selbstbeschaffung bei nicht fristgemäßer Entscheidung) muss die Krankenkasse über den Antrag des Versicherten innerhalb von 3 Wochen entscheiden (wenn die Krankenkasse selber entscheidet) bzw. innerhalb von 5 Wochen (wenn sie den MDK einbindet, wobei sie letzteres dem Versicherten innerhalb von 3 Wochen mitteilen muss). Nur worüber die Krankenkasse so genau entscheiden soll, wenn sie die Unterlagen nach dem Motto „wie Sie sehen, sehen Sie nichts“ vorgelegt bekommt. Denn in der Regel bekommen die Krankenkassen so nur eine nackte Verordnung (wie bei einem Hustensaft) und sonst nichts. Eine Entscheidung über Anschaffungskosten von vielen tausend Euro und monatlichen Kosten von mehreren hundert Euro lässt sich hierauf sicherlich nicht stützen. Die Frist ist auch mächtig kurz, damit die Krankenkasse 1.) eine erste Prüfung durchführt, die Unterlagen fertig macht, 2.) die notwendigen Unterlagen an den Versicherten schickt, 3.) dieser einen Termin beim Facharzt macht, um die Sachen zusammenzusuchen und der Facharzt dann eine Stellungnahme schreibt, 4.) die Unterlagen an den MDK versandt werden (erneut per Post), 5.) der MDK ein Gutachten erstellt und dieses an die Krankenkassen schickt und 6.) die Krankenkasse auf nun erstmals vorliegenden Unterlagen eine Entscheidung trifft, ohne, dass Zeit für weitere Nachfragen wäre.
In der Praxis führt das dazu, dass die Krankenkassen häufig die Anträge einfach ablehnen, um die Frist zu eliminieren und das eigentliche Antragsverfahren in das Widerspruchsverfahren verlagert wird. Ob das so sinnvoll und zweckmäßig ist, dürfte freilich auf einem anderen Blatt stehen. Jedenfalls führt das zu einer erheblichen Verlängerung des Verfahrens; zu Lasten der Versicherten.

Jan hat deutsches und niederländisches Recht in Bremen, Oldenburg und Groningen studiert und ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht in einer Kanzlei für Medizin- und Sozialrecht in Bochum. Außerdem hat er eine Zusatzausbildung im Datenschutz (Datenschutzbeauftragter DSB-TÜV) gemacht. Schon während seines Studiums engagierte er sich ehrenamtlich im Bereich Diabetes, insbesondere zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen, und hat die Selbsthilfeorganisation Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH‑M) e. V. mitbegründet und aufgebaut. Er engagiert sich zudem in der Stiftung Stichting Blue Diabetes.